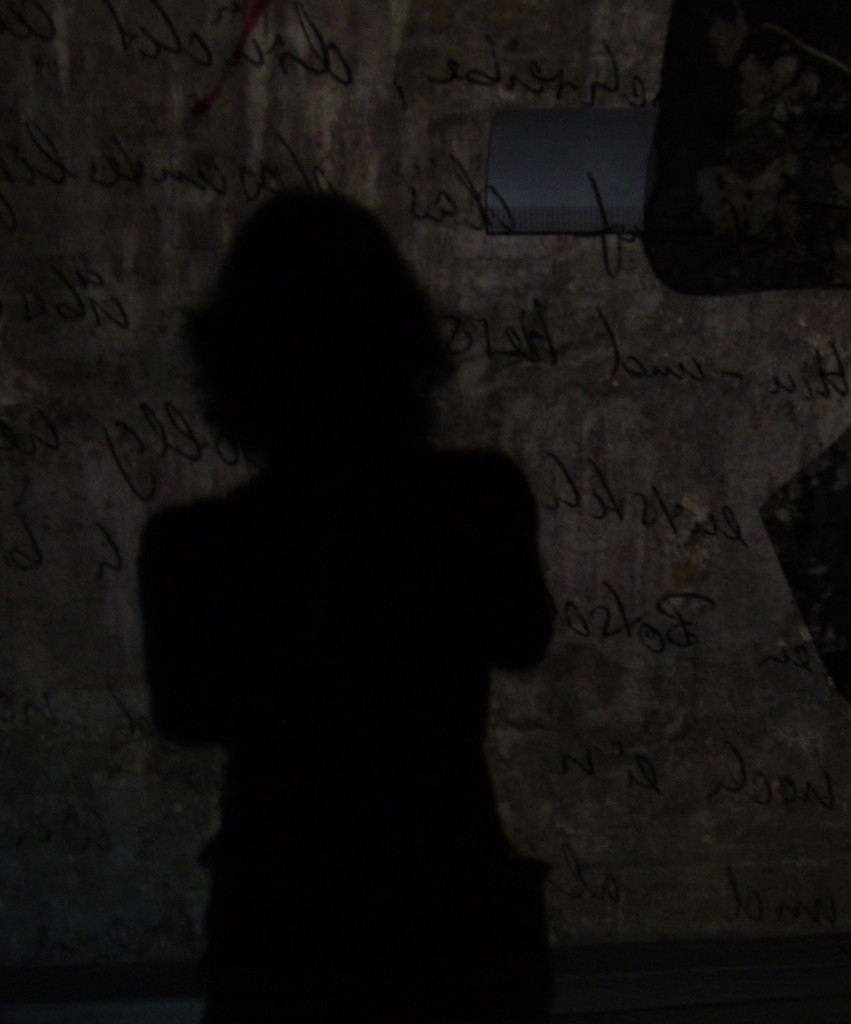Am 9. September wäre meine Lieblingsomi 95 Jahre alt geworden. Sie starb in einer Winternacht vor zwei Jahren. Sie fehlt mir noch immer. Sie war eine weise Frau, eine schöne Frau. Sie liebte meine Texte im Magazin der Berliner Zeitung und war enttäuscht, wenn wieder ein Wochenende ohne einen meiner Artikel begann. Sie hat sich mit meinen Gedanken, Ideen und Zielen auseinander gesetzt wie keine zweite Freundin. Sie war meine beste Freundin.
Sie empfahl mir, große Ketten zu tragen, so wie sie immer große Ketten über ihren schlichten Wollpullovern getragen hatte. Doch ihr Rat meinte mehr: Er meinte, dass ich stärker, raumnehmender, auffallender agieren sollte. Ein Jahr nach ihrem Tod habe ich mir eine lange, große Kette aus gelben Holzperlen gekauft.
Eigentlich war sie gar nicht meine Großmutter, sondern die Großmutter von Stefan Schrader, mit dem ich eine Zeitlang verheiratet war. Und sie war die Urgroßmutter unserer gemeinsamen Tochter Selma. Die Verbindung zu ihr ist nie abgerissen. Sie wurde mit den Jahren immer stärker.
Für sie habe ich diese Geschichte geschrieben.
Am Ende der Nacht (2009)
Großmutters Haar
In dieser Nacht schien der Mond so hell, dass die Schornsteine Schatten aufs Dach warfen. Ich wollte die Spätsommernacht über der Stadt genießen, von oben aus einer anderen Perspektive auf mein Leben blicken, nichts bewerten, sondern spüren, was war und ist, und vor allem: Vincent nicht anrufen. Die Dachpappe stachelte meine nackten Beine.
Peter war schon vorgefahren, um das Segelboot flott zu machen. Morgen würde ich ihm folgen. Meine Tasche stand gepackt im Flur. Wieder schaute ich mir zu wie einer Schlafwandlerin, die auf einem Brückengeländer geht, tollkühn und zugleich ohnmächtig, getrieben von einem selbstmörderischen Verlangen. Ich sehnte mich nach Großmutter. Sie war die Einzige, mit der ich über diesen Zustand hatte reden können. Ihr Sterben lag schon Monate zurück. Ich vermisste unsere Gespräche in ihrer mit Weltliteratur und religiösen Schriften aller Konfessionen voll gestopften Wohnung. Großmutter konnte im selben Moment heiter und streng sein, wie ein Zen-Mönch.
Es heißt, dass man über die Haare eines verstorbenen Menschen Kontakt zu ihm aufnehmen kann. Gegen Mitternacht kroch ich nach unten und suchte in den Pullovern, die ich bei der Wohnungsauflösung in eine Papiertüte gepresst hatte, nach einem ihrer langen, weißen Haare. Auf dem Rücken des ockerfarbenen Wollpullovers fand ich eins. Ich zupfte es vorsichtig ab. „Kannst du kurz rüber kommen, bitte?! Es ist dringend! Ich komme einfach nicht klar.“ Während ich auf sie wartete, fiel mir plötzlich das Kuvert mit Vincents Kinderlocken ein. War es überhaupt noch da? Oder hatte ich es ihm zurückgegeben? Hatte ich es nach unserer Trennung etwa weg geworfen? Ich ringelte Großmutters Haar in die kleine, russische Schatulle aus Holz. Auch diese Schatulle hatte ich aus ihrer Wohnung mitgenommen, außer den Pullovern, einigen Büchern und Pflanzen. Das Kuvert mit Vincents Haaren lag wie eh und je zwischen abgelaufenen Visa – und Chipkarten in der Schublade des Vertiko: weich gewölbt von einem dichten Bündel kupferroter Kinderlocken. Es war vierzig Jahre alt. Ein Datum und Vincents Name standen darauf. Seine Mutter hatte es beschriftet.
Als Vincent sich meldete, brachte ich außer einem kläglichen „Ja, ich!“ kein Wort heraus. Eigentlich war es seine Gewohnheit, sich mit diesen beiden Worten zu melden und dann nichts mehr zu sagen. Aber sein „Ja, ich!“ klang ungeduldig. Es war eine drängelnde Aufforderung zum Reden. Kurz nach unserer Trennung vor einem Jahr hatte er täglich angerufen und als ich ihn darum gebeten hatte, es sein zu lassen, hatte er noch eine Zeitlang jeden zweiten Tag angerufen. Inzwischen beschränkte er sich auf einen Anruf pro Woche. Sein „Ja, ich!“ und das fordernde Schweigen anschließend machten mich jedes Mal wütend. Als wartete ich den lieben, langen Tag nur auf seinen Anruf.
Ich hatte unsere Trennung vorangetrieben. Kurz vor meinem 35. Geburtstag hatte ich beschlossen, nicht länger die Geliebte eines verheirateten Mannes zu sein. Aber ich war so inkonsequent, seine Anrufe anzunehmen. Ich wartete auf seine Anrufe. Er hatte Recht mit seinem „Ja, ich!“ Das war es, was mich so wütend gemacht hatte. Erst seit Peter aufgetaucht war, kam ich mit dem Abschied von Vincent klar. Fast.
Peter war mit dem Mountainbike an der Badestelle vorbei gekommen, die meine Schwester mit den Kindern und ich häufig besuchten. Ich hatte ihn sofort erspäht. Er hatte den Blick über den See schweifen lassen, dann das Rad in den Sand gelegt, sich dahinter gesetzt, die Wasserflasche aus der Halterung genommen, getrunken und auf das Wasser geschaut. Sein glänzender Fahrradanzug hatte fest an seinem Körper gesessen. Nicht das geringste Gepäck. Zwischen den Decken, die im Laufe des Tages am Strand versandet waren, den klebrigen Sonnenschutztuben, den Windelpackungen, Thermoskannen und abgestürzten Eiswaffeln, in Kindergeschrei und Elterngezeter hatte er die Unabhängigkeit schlechthin verkörpert. Die Familien schienen ihn nicht zu stören. Er war keiner dieser Singles, die sich naserümpfend abwandten und in der nächsten Bucht verschwanden. Er schien ohne Ballast durchs Leben zu gehen. Ein glücklicher Mensch. Ich hatte den Blick nicht von diesem Phänomen wenden können, bis die Kinder meiner Schwester aus dem Wasser gestürmt kamen und direkt neben mir wie junge Hunde das Wasser aus ihren Pelzen schüttelten. Mit einem Satz war ich auf den Beinen gewesen. Sie hatten gelacht und den roten Ball nach mir geworfen. Ich war in Peters Richtung geflüchtet. Am nächsten Abend, bei einem grünen Tee, hatte er mir erzählt, dass er allein lebe und dass er Chemiker sei und in einer kleinen Pharmafirma an der Entwicklung besserer Kontrastmittel arbeite. Seine Arbeit diene dazu, Tierversuche zu verhindern, zumindest einen großen Teil von Tierversuchen. Seine Hände hatten schmal um die Teeschale aus durchsichtigem Porzellan gelegen. Mein erster Eindruck hatte sich bestätigt: Er war ein glücklicher Mensch. Er verbesserte die Welt. Diesen Mann wollte ich lieben. Ich würde ihn lieben. Es war nur eine Frage der Zeit, des Vertrauens, das sich langsam aufbauen musste.
Vincents Kinderlocken waren in dem Kuvert so dicht, dass meine Finger darin stecken blieben. So stand ich, in einer Hand das Telefon, an der anderen das Kuvert wie eine kleine Handtasche.
„Alles in Ordnung bei dir?“, fragte Vincent.
„Ja“, sagte ich. Und als er nichts erwiderte: „Ja.“ Und noch zweimal: „Ja! Ja!“ Wie von Sinnen.
„Ich habe Sehnsucht nach Großmutter“, sagte ich.
„Sie ist bei dir“, tröstete er. „Du kannst mit ihr sprechen. Du kannst ihr alles sagen. Ich rede auch mit meiner Mutter. Über alles.“
Ich betrachtete die zierliche, altmodische Schrift von Vincents Mutter auf dem Kuvert. „Ich möchte dich treffen“, sagte ich.
„Jetzt?“ Er war überrascht.
„In einer halben Stunde?“
Er seufzte, lustvoll überfordert. Dass er es immer noch wollte, selbst unter Schwierigkeiten, beruhigte mich.
„Wo? Ich habe wenig Zeit.“
Ich spürte die alte Eifersucht. Es hatte Nächte gegeben, in denen ich besser damit klar gekommen war.
„Dann sollten wir nicht länger palavern, sondern uns in Bewegung setzen“, sagte ich.
Im Hof des Speichers tanzten Paare unter Licht-Girlanden Tango. Vincent kam zehn Minuten zu spät. Er tänzelte in Jeans und weißem Hemd über den Platz, das Jackett über der Schulter. Seine glatten Wangen dufteten nach Minze. Wir quetschten uns in die Bar nebenan, die von allen nur Das Klo genannt wurde, weil sich der Raum nicht größer anfühlte als eine geräumige Toilette. Wie gewöhnlich riefen wir unsere Bestellung in Richtung der Bar: Zwei Espresso.
„Kommst du zurecht?“, rief Vincent in den Lärm. Er blickte über mich hinweg und drängelte an den Tresen. Ich nickte.
„Es läuft also gut bei dir?“ Er zerrte sein Telefon hervor und blickte auf das Display.
„Geht so.“
„Wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit…“
Ich legte meine Hand auf seinen Arm. „Ich brauche kein Geld. Ich wollte dich sehen. Das ist alles.“ Wir hatten uns bis zum Tresen vor gearbeitet. „Und du glaubst, dass die Toten da sind und uns hören? Seit wann bist du gläubig? Ich dachte immer, du verabscheust die Religionen.“
Vincent bestellte ein Schokoladentörtchen. „Das hat mit Religion nichts zu tun“, sagte er, lockerte die Ärmel und schob sie nach oben. Die Haare auf seinen sommersprossigen Armen hatten noch denselben hellen Ton wie die Locken in dem Kuvert. Aber sein Kopfhaar hatte sich zu einem tiefen, rostigen Braun gewandelt. Er trug es kurz geschnitten. Wir ließen uns zwei Gabeln reichen und begannen, das Törtchen zu essen. Vincent verspeiste seine Hälfte schnell. Er legte seine Hand auf meine nackten Knie. „Ich muss leider. Zu dumm, lohnte sich gar nicht, aber ich wollte dich unter keinen Umständen im Stich lassen.“ Er schaute wieder in sein Display. „Treffen wir uns morgen wieder?“
„Morgen geht es nicht“, sagte ich.
Er grinste. „Geht Madame mal wieder auf Reisen?“ Ich fühlte mich ertappt, wich ihm aus. Mein Blick fiel auf den Rest des Törtchens, der sich auf dem Teller krümmte. Ich verschlang das kleine Biest. „Ich hätte es wissen müssen“, sagte er. „Du rufst immer nur an, wenn du verreist.“
Es war mir noch gar nicht aufgefallen, aber Vincent hatte Recht. Das letzte Mal hatte ich ihn auch vor einer Segelpartie mit Peter angerufen. Es war, als müsste ich in unserer Glut stochern, bevor ich dem anderen begegnen konnte. Aber warum?
„Bist du glücklich?“, fragte Vincent. Ich nickte und zog ein ungefähr passendes Gesicht. „Und wo verbringt Madame neuerdings die Wochenenden?“
„Auf dem Wasser. Ich segle.“
„Wie langweilig“, sagte Vincent.
Er würde nicht nach Peter fragen. Wir hatten auch niemals über seine Frau gesprochen.
Peter hingegen wusste, dass ich Vincent noch traf. Er war allerdings nicht eifersüchtig. Es widersprach seinem Wesen, eifersüchtig zu sein. Er war Segler, ein Windgeschöpf. Freiheit ging ihm über alles. Er gestand sie jedem zu.
„Das Segeln lüftet meinen Kopf“, sagte ich. „Ich kann mir jetzt eingestehen, dich noch zu lieben, ohne gleich wütend zu werden, weil du alles hast, was ich nicht habe: ein sicheres Familiennest und Kinder.“
Vincent starrte der Bar-Frau ins Dekolletee. „Wenn du wüsstest, was ich deinetwegen durchgemacht habe“, seufzte er. „Irgendwann werde ich dir alles von mir erzählen. Die ganze Wahrheit.“
„Nicht nötig. Ich will es nicht wissen“, sagte ich, etwas schroff.
Ich rieb die Haare auf seinem Arm heftig gegen den Strich. „Weißt du, warum Männer überall Haare haben?“
„Weil wir Tiere sind“, sagte Vincent.
„Weil Frauen Männer nach dem Duft auswählen. Haare sind die besten Duftträger. Ihr stänkert durch die Landschaft, damit wir den richtigen sofort erschnüffeln.“ Vincent erwiderte nichts, beobachtete sein Telefon, das er halb aus der Hosentasche gezogen hatte.
Es war ausgeschlossen, dass Vincent und Peter ähnliche Duftmoleküle aussandten.
„Also lenk nicht ab“, sagte Vincent. „Du bist glücklich?“ Er schüttelte Tropfen von der laminierten Getränkekarte.
„Ja doch, ja, ja, ja.“ Wie von Sinnen.
„Ich muss wissen, wie es dir geht. Es ist mir wichtig“, sagte er. „Das ist der einzige Grund meiner Anrufe. Was auch sonst? Ich halte dich nicht. Aber ich lasse mir nach sieben Jahren nicht verbieten dich anzurufen.“ Er stürzte einen Wodka hinunter und drehte das leere Glas in den Fingern. „Weißt du, man kann einen Menschen so sehr lieben, dass man ihn gehen lässt.“
Es war gegen zwei, als wir die Bar verließen. Kein Wort mehr von seiner Verabredung. Wir liefen schweigend durch die Straßen. Ich genoss seinen Duft, der so subtil war, dass ich ihn nicht bewusst wahrnahm. Trotzdem konnte ich ihn beschreiben. Es war der betörende, tropische Duft dickfleischiger Orchideen.
„Hattest du niemals Gewissensbisse?“, fragte ich.
„Wie kann man Gewissensbisse haben, wenn man liebt?“ sagte er.
„Du hast sieben Jahre lang gelogen“, sagte ich.
„Nein“, sagte Vincent. „Ich habe nicht gelogen.“
Großmutter hatte sich immer nach Vincent und Peter erkundigt. Kurz bevor sie gestorben war, hatte sie gesagt: „Eines Tages wirst du wissen, was du tun musst.“ Dieser Tag schien gerade in weite Ferne zu rücken. Wir waren an meiner Haustür angekommen. „Kommst du mit rauf?“, bat ich. Vincent stöhnte, lustvoll überfordert.
Wir fielen heftig übereinander her. Es war der erste Sex nach unserer Trennung vor einem Jahr: befangen, wie eine kalte Dusche, heroisch, unter Luftnot. Aber danach prickelte mein Körper. Ich fühlte mich wie neu. Wie eine aus einem Stück gegossene Figur lagen wir unter dem offenen Fenster. Ich konnte lange nicht schlafen, lauschte Vincents Atemzügen und dachte an Peter, an seine Hände in meiner Taille, wenn er mich aus dem Wasser zurück auf das Boot hob.
Als ich gegen Mittag erwachte, war Vincent gegangen. Ich schrieb Peter, dass ich einen Zug später kommen würde, steckte die russische Schatulle mit Großmutters Haar in meine Reisetasche und fuhr zum Bahnhof.
Ich flog durch Felder, auf denen runde Strohballen lagen, vorbei an Hecken, in denen Greifvögel rasteten. Hochspannungsleitungen wölbten sich mir entgegen. Sträucher peitschen im Fahrtwind auseinander. Die Erinnerung an die vergangene Nacht durchwärmte jedes Bild und meine Vorfreude auf Peter. Ich brauchte Vincent, um Peter zu lieben. So war es also. Wieso wurde mir das erst jetzt klar? Andererseits brauchte ich Peter, um nicht an Vincent zu leiden. Ich kramte in der Reisetasche nach der Schatulle und öffnete sie. Ich erschrak, weil ich das Haar auf dem rot lackierten Holz zuerst nicht fand. Aber als ich die Schatulle ans Fenster hielt und in der Sonne bewegte, entdeckte ich es wieder: sehr fein und weiß glänzend wie eine Perle.