
Wir müssen nur rasch eines unserer Kinder vom Flughafen Orly in Paris abholen. Dauert nicht lange. Morgen sind wir wieder da.
In diesem Jahr werden wir zu dritt Weihnachten feiern, so richtig mit Geschenken, Baum, selbst gebackenen Plätzchen und Kinderoper.
Quentin lebt in Südamerika, nicht weit vom Äquator. Er hat uns geschrieben, dass er sich auf den Schnee in Europa freut.
Am Gare du Nord krachen die Flügeltüren der Metro hinter uns zu. Wir sind drin. Im Strom der Menschen strudeln wir die Rolltreppe hinab. Unten empfangen uns uniformierte Kontrolleure. Sie legen den Finger an die Mütze und fordern uns auf, die Billets zu zeigen. Schnell muss das gehen, sonst bildet sich ein Knoten.
Weiter durch zugige Gänge. Ein Schwarzer streitet mit einem arabischen Zeitungshändler. Rolltreppen rauf. Rolltreppen runter.
In der Metro schimpft ein junger Mann auf die Kontrolleure. Es sei schließlich nicht seine Schuld, dass die Drucker oben nicht funktionierten. „Sehen Sie sich das an. Nichts.“ Er weist auf den Rand des Schnipsels, wo normalerweise der blaue Zifferncode des Entwerters landet. „Das machen die mit Absicht“, ruft ein älterer Herr. „Haben die Ihnen etwa Geld abgeknöpft?“ Der junge Mann hält eine Rechnung über die Köpfe in Richtung des älteren. „Zahlen Sie auf keinen Fall. Man darf sich das nicht bieten lassen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas.“ Die beiden steigen an der nächsten Station aus, schlendern gestikulierend über den Bahnsteig, ungeachtet der Menschen, die ihnen entgegen zum Zug hasten.
Unser Hotel liegt am Place de la Nation. Wir steigen in den ersten Stock hinauf, schieben den Wäscheberg vor der Tür beiseite und treten in unser Zimmer. Zum Glück haben wir nicht viel Gepäck. Quentin kommt morgen früh. Zwei Koffer würden vermutlich nicht in das Zimmer passen. Zumindest, wenn man das Bad noch erreichen will.
Kurz nachdem wir uns aufs Bett geworfen haben, erreicht Antoine ein Anruf aus Südamerika. Quentin kommt einen Tag später. Alle Flüge sind nach hinten verschoben, weil es gestern in Paris ein Unwetter gegeben hat.
Im Foyer des Hotels beraten wir, was zu tun ist. Das künstliche Feuer im Kamin flackert wie eine sterbende Glühlampe.
Wir telefonieren mit unseren Chefs. Zum Glück ist niemand verärgert. Für Unwetter haben alle Verständnis. Kann jedem passieren. Der Student an der Rezeption verlängert unser Zimmer um einen Tag. Jetzt müssen wir nur noch den Mietwagen umbuchen. In der Autovermietung auf dem Flughafen Orly meldet sich niemand. Wir versuchen es wieder und wieder. Wir rufen die Station in Berlin an. „Kein Problem“, sagt der Mann in Berlin. „Natürlich können Sie umbuchen. Rufen Sie die Kollegen in Orly morgen früh wieder an.“
Ein Tag in Paris. Wir schlendern die Straße hinab. Der Strom der Passanten verdichtet sich, je mehr wir uns den großen Kaufhäusern und glamourösen Läden der City nähern. Ehe wir uns versehen, sind wir in den Strom der Käufer eingeklemmt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Wir werden in das glitzernde Foyer eines Kaufhauses gesogen und durch parfümgesättigte Luft in Richtung Rolltreppe gedrängt. Auf den Förderbändern stehen die Menschen so dicht, dass keine Stecknadel mehr zu Boden fallen kann. Aber unter dem halbrunden Geländer in der zweiten Etage, auf dem Übergang zwischen zwei Rolltreppen, liegt ein blauer Wollhandschuh.
Der Mann, der ihn verloren hat, sucht vermutlich draußen auf der Straße in seinen Taschen, bleibt stehen, wird angerempelt, beschimpft, weiter geschoben.
Es ist zu eng, um sich nach dem Handschuh zu bücken. Was sollte man auch damit tun? Sich im Gewühl zu einem der überlasteten Verkäufer schubsen? Vielleicht hat der Besitzer des Handschuhs selbst bemerkt, als er ihn fallen ließ, konnte ihn aber nicht aufheben, weil er weiter geschoben wurde, ins nächste Stockwerk, zu den Stapeln glitzernder Weihnachtsdekorationen, den Bündeln bunter Bestecke, Säcken voller Ausstechformen, Stapeln von Pfannen, Tiegeln und Töpfen.
Wahrscheinlich hat er sich gewehrt. Sehen Sie nicht meinen Handschuh? Was sind Sie für ein Egoist! So machen Sie doch Platz! Was heißt hier: Rolltreppe? Ziehen Sie die Notbremse! Sie wissen nicht, wo die ist? Dann rufen Sie die Feuerwehr. Machen Sie schon!
Digital-Kameras, Telefone, Flachbildschirme, Verstärker in Edel-Design, Retro-Radios, das Iphone…Die Luft wird knapp. Wir taumeln entkräftet nach draußen, an ineinander verkeilten Reisebussen vorbei durch Hupkonzerte, im machtvollen Pulk der Fußgänger über rote Ampeln. Die Sirene eines Krankenwagens heult vergeblich gegen den Stillstand im Kreisverkehr.
Für kurze Zeit entkommen wir der Masse in tote Nebenstraßen, bis wir auf einem großen Boulevard wieder in die Orgie eintauchen.
Hier flanieren Bourgois durch luxuriöse Einrichtungsläden. Geduldig warten sie an der Kasse. Sie kaufen Plastikleuchter in ausladenden Formen und schrillen Farben, Tischdekorationen aus Straß, goldene Teller, silberne Schüsseln, Flitter-Flatter, stilisierte Weihnachtsbäume aus Sperrholz und Stahlrohr und kartonweise blau funkelnde Glaskugeln. Hinter der Kasse lassen sie sich goldene Schleifen um den Edelkitsch binden. Das dauert Stunden. Stunden, in denen sie sich mit dem Personal am Packtisch über die Trends austauschen und darüber, wie sie im letzten Jahr mit wem und wo und dass es im Grunde jedes Jahr dasselbe, aber diesmal doch anders…
Die Designläden sind randvoll gefüllt mit Zen. Zen, das sind japanische Büroartikeln und Seifenspender. Zen sind Platzdeckchen und minimalistischer Baumschmuck. Ein Werbespot auf einer Großleinwand verspricht Zen sogar in einem Joghurt.
„Du warst noch nie in den Galeries Lafayette?“, fragt Antoine. „Nein“, sage ich. „Es hat mich nicht interessiert.“
„Du musst dir das Haus unbedingt ansehen.“ Antoine zieht mich weiter, vorbei an pelzgemäntelten Damen vor luxuriösen Auslagen. Das Publikum fasert auf die Straße aus, weil die Bürgersteige zu schmal sind. Polizisten auf Fahrrädern winken die Autos an dem Konsum-Tross vorbei.
Über uns wölbt sich die goldene Kuppel des Kaufhauses. „Möchtest du etwas? Ein neues Parfüm? Ich schenke es dir zu Weihnachten“, sagt Antoine. Ich schüttele den Kopf. Es ist zu laut zum Reden. Es ist zu viel zum Wünschen. Zum Glück gibt es mehrere Ausgänge.
Wir pressen uns in eine Metro und fahren zurück zum Hotel.
Am nächsten Morgen erreicht Antoine die Autovermietung auf dem Flughafen. Er sitzt auf dem Barhocker vor dem Internet-Computer im Foyer des Hotels. Ich habe mich neben die Kaminfunzel zurückgezogen und blättere in einem Einrichtungsmagazin. Es zieht mich zu den Zen-Tempeln. Vielleicht kaufe ich den Weihnachtsbaum aus Stahlrohr.
Eine kleine, blonde Frau tritt aus dem Fahrstuhl. Sie ist mit nichts außer einem Spitzenhemdchen und einem Handtuch um die Hüften bekleidet. „So etwas ist mir noch nie passiert“, schimpft sie. Der Student an der Rezeption blickt über den Tresen. „Mein Zimmer ist nicht gemacht. Ich habe es eben beim Duschen bemerkt.“ Sie bleibt mitten im Foyer, vor der Eingangstür, stehen. Sie ist barfuß. Ihre Haare sind mit Klemmen hoch gesteckt.
Der Mann an der Rezeption entschuldigt sich und fragt nach ihrer Zimmernummer.
Antoine scheint Schwierigkeiten mit der Autovermietung zu haben. „Was heißt, es geht nicht?“, ruft er in den Hörer. „Wieso geht es denn nicht? Haben Sie nur das eine Auto? Ich dachte, Sie wären eine der größten Autovermietungen Europas.“
„Ich möchte sofort den Hotelbesitzer sprechen“, zetert die Blondine.
Die Hoteldirektorin, eine drahtige Frau in den Fünfzigern, schlendert ins Foyer. „Es sind Haare in der Dusche“, beschwert sich das Mädchen. „Das ist widerlich.“
„Das Zimmer ist gemacht“, gibt der Junge an der Rezeption gelassen zurück. „Ich habe mit dem Service gesprochen.“
„Sie sollen sich die Dusche noch einmal anschauen“, weist die Dame des Hauses ihn an.
„Das ist alles?“, faucht das Mädchen. „Keine Entschuldigung?“
„Ich habe mich entschuldigt, Madame“, sagt der Student.
Die Hoteldirektorin schüttelt nervös ein Schlüsselbund. Sie grinst in meine Richtung.
Hinter mir kämpft Antoine immer noch mit der Autovermietung. „Sie sind zuerst laut geworden, Monsieur. Ich habe nur eine Frage gestellt. Eine ganz normale Frage. Meine Frage: Wieso können Sie den Wagen nicht einfach bis morgen stehenlassen? Haben Sie keine Parkplätze? Ihre Kollegen in Berlin…“
„Wir schauen uns die Dusche jetzt noch einmal an und bringen das in Ordnung.“
„Jedenfalls ist es das letzte Mal, dass ich hier war.“ Das Mädchen zieht ein Telefon unter ihrem Handtuch hervor.
„Sie sind frei.“ Die Direktorin zuckt die Schultern. Das Mädchen tippt mit spitzen Fingernägeln eine Nummer. Sie beschimpft ihr Opfer, das absolut mieseste Hotel in ganz Paris für sie gebucht zu haben. Sie droht Maßnahmen an.
Die Hotel-Dame macht auf dem Absatz einen Schwenk und verdreht die Augen.
„Ich möchte ihren Vorgesetzten sprechen“, verlangt Antoine. Ich überlege, wo in unserer Wohnung der Zen-Baum am besten zur Wirkung käme.
„Wieso spät?“, ruft Antoine. „Es hat einen Sturm gegeben. Alle Flüge sind verschoben. Das müssen Sie doch gemerkt haben.“
Nach weiteren zwanzig Minuten Diskussion reserviert man uns einen Wagen am Gare du Lyon.
Die Blonde krakeelt noch im Aufzug in ihr Telefon.
Am nächsten Tag stehen wir auf, als die erste Metro unter unseren Betten entlang rumpelt. Im Stau auf der Autobahn rücken wir langsam an die Peripherie der Stadt. Motorradfahrer wedeln im Slalom zwischen den sechsspurig schleichenden Autos.
Vor der Abflughalle Orly West tummeln sich karibisch bunte Menschen. Quentin kommt. Schmal und sehr weiß. „Wo ist der Schnee?“, fragt er.
Auch in Berlin liegt kein Schnee. Dafür ist es ruhig wie in einem Kurort. Die Eisbahn neben der Oper haben wir fast für uns allein. Wenige Fußgänger schlendern Unter den Linden entlang. Sie meditieren an roten Ampeln vor freien Straßen. Die Karussells auf dem Weihnachtsmarkt drehen glitzernde Runden. Der Fernsehturm blinkt in den Abend. Berlin ist Zen.
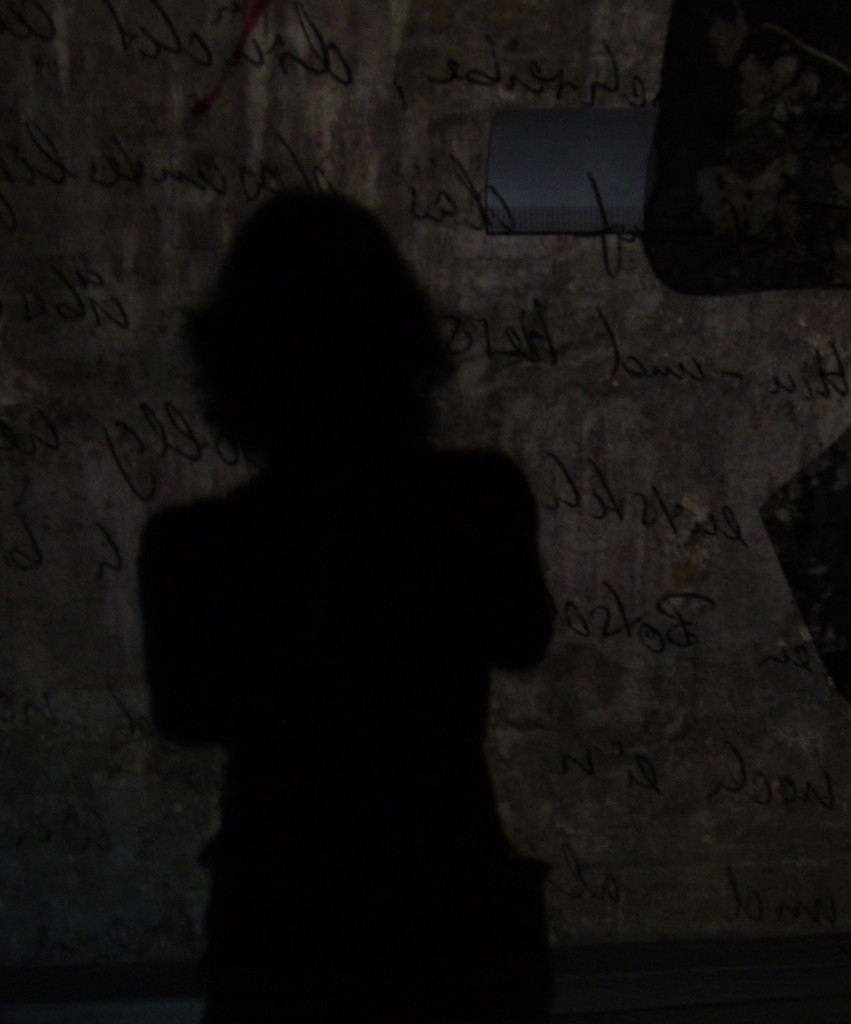


![illu-mit-muschel1[1]](http://www.kathrinschrader.de/wp-content/uploads/2011/01/illu-mit-muschel11.jpg)
