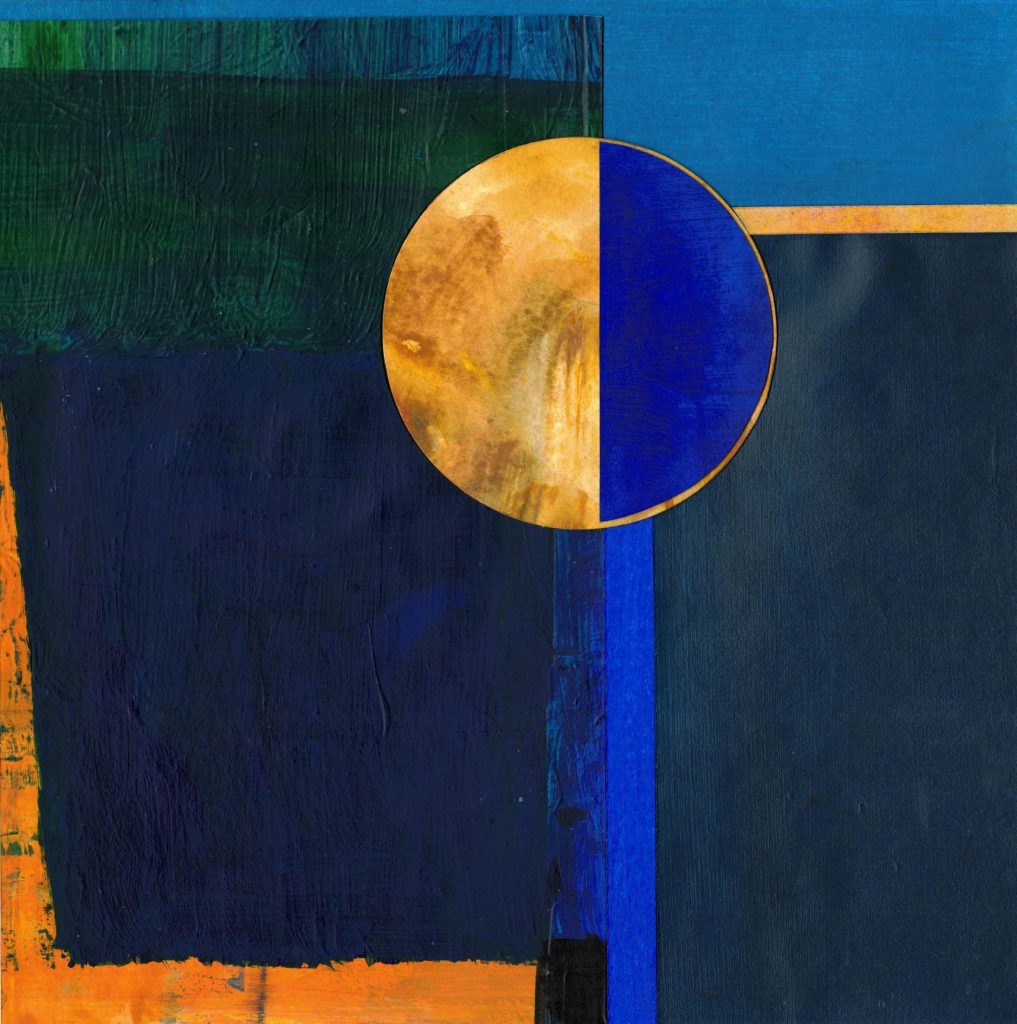Illustration: Tine Schulz @ tine.schulz.illustration
Als wir uns wieder im Trespassers treffen, berichte ich meiner Freundin von den deprimierenden Ergebnissen der Bordell-Recherche. Weltweit gibt es keinen einzigen Puff für Frauen mehr, seit der letzte in den USA 2015 geschlossen wurde. In Hamburg bietet ein Etablissement immerhin sexuell stimulierende Performances ausschließlich für Frauen an.
Und nach der Performance? fragt meine Freundin.
Nichts, sage ich.
Wie? Nichts!? Wer vögelt sie denn anschließend?
In diesem Laden vögelt sie jedenfalls keiner.
Meine Freundin findet das krass. Sie bestellt einen Tequila, obwohl wir uns gerade für eine Flasche Cava rosé entschieden haben.
Angeblich sind Bordelle für Frauen nicht nachgefragt. Ich halte das für einen Irrtum.
Es ist eine Frage der Macht, sagt meine Freundin, wobei sie dem Wort eine Schwerkraft verleiht, die sie vom Barhocker zu reißen droht. Vorsichtshalber lege ich einen Arm um ihre Schultern. Du meinst, dass es eine Frage der Männer-Macht ist, dass es keine Bordelle für Frauen gibt?
Prostitution überhaupt, sagt sie. Es geht dabei nicht um Sex. Es geht um Macht.
Ihr Tequila kommt. Sie streut sich Salz auf den Handrücken, leckt daran und kippt ihn auf Ex runter. Dass ihr das Thema so nahegeht, sorgt mich. Wahrscheinlich kocht in ihr die Geschichte mit ihrem Ex wieder hoch, dem sie auf die Schliche kam, wie er im Netz Frauen zum Fremdgehen recherchierte.
Du musst dir doch nur mal anschauen, wer in den Puff geht, sagt sie. Männergruppen, die Geschäftsabschlüsse oder sportliche Siege feiern und nicht wissen, wohin mit ihrem Testosteron. Thats it!
Ich hingegen hatte Umfrageergebnisse gelesen, denen zufolge die meisten Männer im Bordell menschliche Nähe suchen und jemanden zum Reden.
Diese Kerle lügen doch, ruft meine Freundin. Geburtstagsfeiern enden übrigens auch gern im Bordell. Nach dem Besäufnis schmeißt das Geburtstagskind eine Runde Nutten.
Woher weißt du das alles?
Das weiß man doch, sagt sie und guckt mich an, als käme ich vom Pluto, dem letzten Steinklumpen hinter der Sonne, der inzwischen als Planet abgewickelt wurde, so eine Art DDR des Sonnensystems. Meine Freundin ist im Westen groß geworden. Erklärt das ihren Wissensvorsprung? In der DDR gab es keine Puffs, jedenfalls nicht offiziell. Während sie, vierzehnjährig, kaugummikauend, ihren Beobachtungsposten an der Hausecke gegenüber dem Kleinstadt-Bordell bezogen hat, war ich in Dresden auf Gerüchte angewiesen, die unter der Hand weitergegeben wurden.
Zu meiner Jugendweihe luden meine Eltern die Familie zum Essen ins Interhotel Newa ein. Am Tisch nebenan saß eine Gruppe Männer. Schweden, sagte mein Vater sprachkundig. Er war zu dieser Zeit bereits ein bisschen rumgekommen in der Welt, weil er Maschinen für Schiffe konstruierte. Als die Schweden zahlten, fragte einer den Kellner auf Englisch, wo sie Ladies treffen könnten.
Ich weiß nicht mehr, was der Kellner ihnen antwortete, ob er ihnen überhaupt antwortete oder nur einen Zettel mit einer Adresse rüberschob. Ich war vollständig absorbiert von der Frage, wieso die Schweden um diese Zeit Ladies treffen wollten und an wen sie dabei dachten. Ich kannte nur Lady Di. Sie lebte in einem Palast in London. Hatten die Männer etwa in Schloss Moritzburg oder im Pillnitzer Schloss Ladies erwartet?
Wenig später ging das Gerücht, in einem verfallenen Haus in unserer Nähe befände sich ein Bordell. Das Haus war von Bäumen und Gestrüpp umgeben. Nur hier und dort blitzte ein Stück bröckelnde Fassade durch das Grün. An der Gartenpforte befand sich eine kaputte Laterne, wie sie an den Eingängen von Gasthäusern hängen. Jeden Tag, wenn ich mit dem Bus von der Schule nach Hause fuhr, schaute ich, ob wieder ein Auto in der Einfahrt stand. Ich stellte mir vor, wie der Mann aus dem Wagen das Haus betrat, wie eine ältere, dickliche Dame in die Hände klatschte und die Prostituierten sich auf das Signal nackt in einer Reihe aufstellten.
So hatte ich es in einem der französischen Filme gesehen, die spät abends im DDR-Fernsehen liefen. Seit meiner Jugendweihe durfte ich sie mit anschauen.
Der Mann im Film entscheidet sich für eine sehr große, sehr dünne Frau mit strähnigen Haaren. Seine Wahl beschäftigte mich für den Rest des Films, so dass ich mich nicht mehr auf die Handlung konzentrieren konnte. Sucht er gar nicht Schönheit, sondern Vertrautheit? Oder Bewunderung? Sucht er jemanden zum Reden? Fürchtet er den Stolz der attraktiveren Frauen, die ihm dominant die Spitze ihrer High Heels in den Schenkel bohrten? Was, zur Hölle, will der Mann im Puff?
Das schlimmste Ergebnis meiner Recherche habe ich meiner Freundin noch nicht erzählt. Ich schenke ihr das nächste Glas Cava ein. Was denkst du, was passiert, wenn Frauen in ein gewöhnliches Bordell gehen? Als Freier sozusagen, einfach nur, um in den Arm genommen zu werden und zu reden. Ist ja nicht völlig abwegig …
Garantiert zahlt sie für Reden mit Umarmung dreimal so viel wie ein Mann fürs Vögeln, sagt meine Freundin.
Trifft zu, aber nur für die Bordelle, die Frauen überhaupt empfangen. In den meisten werden sie nämlich abgewiesen. Und weißt du auch, warum?
Kann ich mir denken. Aber sag schon!
Darauf kommst du nicht! – Weil sich die Freier von ihrer Anwesenheit gestört fühlen könnten.
Meine Freundin prustet den Cava aus und rutscht jetzt wirklich vom Hocker.
Das ist so geil, sagt sie. Weißt du was? Wir gehen Männer stören im Puff.
Meine Freundin hat immer gute Ideen, aber in der Kombi aus Tequila und Cava läuft sie zur Höchstform auf.
Ihr Schmerz ist vergessen. Sofort machen wir einen Plan. Wir gehen in den Puff, setzen uns einfach dazu und fragen die Männer, wie sie es so mögen, was sie so mögen und wieso sie eigentlich so arme Würstchen sind, dass sie dafür bezahlen müssen … Meine Freundin krümmt sich. Wir fragen sie, ob sie ihre armen Würstchen mit Viagra oder einem guten Geschäftsabschluss pushen.
Wenn sie uns rausgeworfen haben, ziehen wir weiter, in den nächsten Puff.
Sie werden uns jagen. Aber sie kriegen uns nicht.
Sie wollen wissen, wer wir sind.
Die Phantominnen der Puffs. Wooo! Wir werden stadtbekannt.
Wir werden berühmt.
Wir sind überwältigt von unserer Idee.
Ich frage meine Freundin, wie es in einem Puff aussieht. Sie sieht mich an, als hätte ich ihr in den Sekt gespuckt. Typisch Westfrau. Tut so, als wäre sie Bordell-Expertin und hat keinen Schimmer, wie es dort überhaupt aussieht.
Ich erzähle von dem französischen Film, dessen Titel ich allerdings vergessen habe. Ich weiß nicht einmal, wer der Schauspieler war. Es war weder Michel Piccoli noch Jean-Louis Trintignant, auch nicht Delon. Meine Freundin kennt weder Piccoli noch Trintignant. Von Delon hat sie gehört.
Ich kann es nicht fassen. Sie kennt eigentlich alle und jeden. Hast du nicht ferngesehen?
Klar, aber doch keine Ostsender.
Wir beschließen, dass es in einem Puff ein Foyer geben muss mit einem Tresen, und dass in diesem Raum wartende Männer abhängen, die wir belästigen können.
Wir brauchen genial gute Masken. Inspiriert vom venezianischen Karneval?
Eine Perücke macht es auch, falsche Wimpern und krasse Schminke, sagt meine Freundin. Aber was ziehen wir an?
Gute Frage. In meinem Kleiderschrank hängen nur Sachen, die mich auf den ersten Blick als Schriftstellerin entlarven.
Wir brauchen was Abgefahrenes, sagt meine Freundin. Wir könnten so tun, als seien wir Prostituierte, die sich bewerben, schlägt sie vor.
Du denkst an Glitzerfummel? Habe ich nicht. Wir könnten uns als Freier verkleiden, ohne zu verstecken, dass wir Frauen sind, verstehst du? Anzug und Krawatte, die Krawatte gainsbourgmäßig, so ein Strick. Du weißt schon.
Meine Freundin weiß es nicht. Immerhin kennt sie Serge Gainsbourg. Ich zeige ihr das berühmte Foto. Oder so birkinmäßig, mit Kaschmirpulli und Jeans. In diesem Look können wir gut flüchten. Das wäre praktisch. Ich muss plötzlich an die Szene aus dem Film „Das wilde Schaf“ denken, in der Trintignant Jane Birkin im Stundenhotel schlägt, nachdem sie sich ausgezogen hat. Die Szene bereitet mir jedes Mal Schmerzen, aber Birkin verkörpert perfekt Ekel, Scham und Wut. Trintignant ist in diesem Film ein armer Hund, der seinen Schmerz an einer Frau auslässt.
Meine Freundin findet, dass High Heels ein Muss für den Auftritt sind. Wenn wir keine Prügel beziehen wollen, müssen wir aussehen wie Frauen, sagt sie.
Wir besitzen beide keine High Heels. Meine Freundin googelt Kostümverleihe, Theaterfundi und Läden.
Wir müssen unsere Rollen klar definieren, sage ich.
Gott, du klingst wie eine Lehrerin, sagt meine Freundin. Zuerst einmal sind wir gefährlich.
Provokant, ergänze ich.
Wir machen sie fertig, sagt meine Freundin.
Wir sollten nicht übertreiben, mahne ich. Denk dran! Männer sind auch Menschen.
Die Augen meiner Freundin werden zu schmalen Schlitzen. Hast du etwa Mitgefühl mit Typen, die in den Puff gehen? Vergiss nicht! Es ist eine Frage der Macht.
Ich sehe die traurigen Augen von Philippe Noiret, in dem Film, in dem er eine Prostituierte in sein privates Sado-Maso-Studio einlädt. Er will gern brutal sein, aber er ist kein harter Typ. Er schildert der Prostituierten, was er mit den Geräten und ihr machen will, aber er tut es nicht. Einmal fesselt er sie halbherzig, aber die meiste Zeit sitzen sie zwischen all den Instrumenten und reden. Er blickt sie melancholisch an, völlig von ihr gefesselt.
Als die Flasche Cava leer ist, diskutieren wir noch immer das Kostüm für unseren Auftritt, und als das Trespassers schließt, reden wir auf der Straße weiter. Ich mag keine High Heels und Glitzerfummel, kann meine Freundin aber weder vom Birkin- noch vom Gainsbourg-Look überzeugen. Die Wirkung von Tequila und Cava hat nachgelassen. Im Morgengrauen dämmert uns, dass es eine Schnapsidee war. Wir erklären unsere Intervention im Puff für gescheitert. Wir haben nichts anzuziehen.